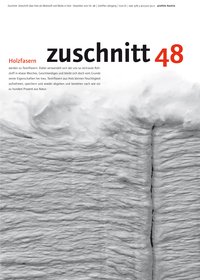Drei facettenreiche Statements – naturgemäß divergent aus dem Blickwinkel von drei Forschern (und Anwendern) in unterschiedlichen Professionen: ein Blick in die Zukunft des Holzes mit Ingo Marini, Manfred Brandstätter und Gerhard Schickhofer.
Er war nicht nur Vorstand des Institutes für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften an der TU Wien, sondern auch Leiter der Arbeitsgruppe Fasertechnik. In der Industrie galt das berufliche Augenmerk des studierten Chemikers Ingo Marini der chemischen Verwertung von Holz für Produkte, deren Grundsubstanz Zellulose ist, jene bedeutende organische Verbindung, die aus Zellstoff gewonnen wird. Die Ausbeute heute sind etwa 40 Prozent Zellulose, der Rest, Lignin, wird beim Kochen verbrannt. Kein Wunder also, dass Marini von einem Rohstoff Holz träumt, der mehr Alpha-Zellulose und weniger Lignin enthält. Wie das gehen soll? Seine Antwort: mit gentechnischen Veränderungen am Rohstofflieferanten Baum.
Hier hätte sich vermutlich Manfred Brandstätter eingeschaltet, wäre unser Interview ein Round-Table-Gespräch gewesen. Der Geschäftsführer der Holzforschung Austria hält die Kittsubstanz Lignin für ein höchst spannendes Material, das weiterverwendet statt verbrannt werden sollte. Lignin könnte als Klebstoff in Holzwerkstoffen verwertet werden, meint er und ergänzt, dass schon lange dazu geforscht werde, ein Durchbruch allerdings noch nicht gelungen sei.
Der Versuch, alles aus dem Rohstoff Holz herauszuholen und bis aufs Letzte zu optimieren, sei eine Gratwanderung, bei der Aufwand und Ergebnis immer wieder in Relation gebracht werden müssten. »Die Prozesskette muss wirtschaftlich Sinn ergeben«, meint Brandstätter und ergänzt, dass weder Prozesse noch Systeme zu komplex werden dürften. Als Beispiel nennt er die Güteklassen: Zu viele Güteklassen würden Planer eher verwirren und abschrecken. Also besser weniger Klassen, aber dafür klare und gut aufeinander abgestimmte Kennwerte. Das beginnt bei den Bauholzklassen und gilt auch für Brettschicht- und Brettsperrholz.
Die Suche nach wirklich neuen Produkten würde sich schon lohnen, etwa nach Hybridbaustoffen, in denen nicht hölzerne Werkstoffe mit Holz oder auch nur unterschiedliche Holzarten miteinander kombiniert werden. Im Versuch, damit anwendungsbezogen Schwächen auszumerzen und Festigkeit, Brandbeständigkeit oder Haltbarkeit zu verbessern, sei sicher noch Potenzial gegeben. Ach ja, und – Thema Leichtigkeit – Materialeinsparungen wären möglich. Im Brettsperrholz sei heute noch zu viel Material in der Platte. Grundsätzlich ist der Forscher der Meinung, dass man nicht alles zerlegen und wieder zusammensetzen muss, weil das mit erheblichem Aufwand, Energieeinsatz und oft mit Materialverlust verbunden ist. »Holz ist von Natur aus ein hoch intelligentes, hoch komplexes Material – vielfältig und effizient einsetzbar –, das man so verwenden kann, wie es ist.« Spätestens hier wird deutlich, dass Brandstätter »mehr von der stofflichen Seite herkommt«.
Das gilt auch für Gerhard Schickhofer, der das Institut für Holzbau und Holztechnologie an der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Graz leitet. Stamm, Brett, Furnier, dann ist beim Bauingenieur, der Tragfähigkeit braucht, Schluss. Sein Ansatz sei, betont Schickhofer mehrmals, die natürliche Ressource Holz in ihrer Vielfältigkeit zu verwenden und zu optimieren, das im Holz liegende Potenzial ganz auszuschöpfen. Stichwort: intelligente Ressourcennutzung.
»Je höher der Zerlegungsgrad, desto geringer wird die Beanspruchbarkeit des Einzelelements. Aber die Möglichkeit der Homogenisierung wird umso größer, je höher der Zerlegungsgrad ist.« Für den Ingenieur ist dies ein wichtiger Punkt, denn durch Homogenisierung wird die Streuung der Materialkennwerte reduziert, etwa von Zug- und Biegefestigkeit. Das Material wird berechenbar. Andererseits geht bei Platten Tragfähigkeit verloren.
Wie kann also der Materialnachteil – die hohe Streuung – reduziert und zugleich die Tragfähigkeit erhalten werden? Schickhofer plädiert einerseits für eine gute Vorsortierung des Holzes und andererseits für Homogenisierung durch Systemwirkung – und für die Verbindung der beiden Prozesse, um Werkstoffgrößen auf hohes Niveau zu bringen. Geschickter Produktaufbau bedingt, was die Forscher des Grazer Institutes »serielles Zusammenwirken« nennen. Nicht ein einzelnes Produkt wirkt, sondern ein System aus parallelen Elementen nebeneinander. »Erst durch den Aufbau von Systemprodukten reduziert sich die Streuung auf 10 bis 15 Prozent.« An unserem fiktiven Round Table hätte Brandstätter der letzten Wortmeldung zumindest in einem Punkt zugestimmt. Auch für ihn steht die stoffliche Verwertung des Holzes an erster Stelle. Um zu sehen, wo Stärken und Potenziale des Stamms liegen, müsse die Scanning-Technologie forcierter entwickelt und angewandt werden. Die Devise: Je früher, desto besser, desto wirtschaftlicher. Was einmal falsch geschnitten wurde, bleibt minderwertig.
Der Tenor ist ein gemeinsamer: Allein in optimierten Verwertungsprozessen ließe sich schon viel mehr an Qualitäten des Holzes herausholen – besser: der vielen Holzarten. In Zukunft, meinen Brandstätter und Schickhofer unisono, müsse man sich stärker mit der Vielzahl der Hölzer beschäftigen, die in Österreichs Forsten stehen. Einige mehr könnten im Bau eingesetzt werden. »Man kann eine Fichte nicht hochtunen«, meint Schickhofer, aber in Laubhölzern wie der Buche, der naturgewachsenen Pappel – in dem, »was man am Weg liegen lässt« – liege ein enormes Potenzial. Die Zukunft des Holzes liegt demnach in der Optimierung des Vorhandenen – in intelligenter Ressourcennutzung eben.

Manfred Brandstätter
Geschäftsführer der Holzforschung Austria
www.holzforschung.at
Ingo Marini
ehemaliger Vorstand des Institutes für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften an der
TU Wien, ehemaliger Leiter der Arbeitsgruppe Fasertechnik
www.vt.tuwien.ac.at
Gerhard Schickhofer
Leiter des Institutes für Holzbau und Holztechnologie an der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Graz
www.lignum.tu-graz.ac.at
Foto:
© Hertha Hurnaus Wien/A, www.hurnaus.com