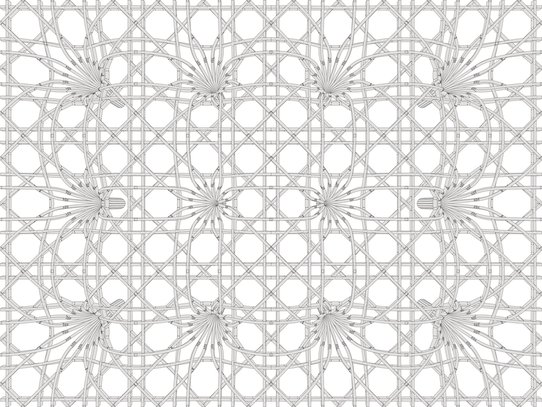Das Ornament gilt als das am schwierigsten zu fassende Element der Architektur, es scheint sich einer klaren Definition zu entziehen. Dementsprechend werden die Debatten darüber hitzig und emotional geführt. Man denke nur an das Postulat, dass die Moderne mutwillig das Ornament abgeschafft oder gar liquidiert habe. Aber wird man damit dem Ornament gerecht und wichtiger noch: Wird man damit der Architektur gerecht?
Doppelte Polung
Die Ornamente sind aber weniger rätselhaft, als sie scheinen. Im Gegenteil, die Debatten darüber sind Indikatoren dafür, dass sich in der Konzeption der Architektur etwas verändert und etwas Neues entsteht. Mit neuen Konstruktionsformen, Verbundstoffen und der Digitalisierung aller Bereiche der Architektur, gerade auch im Holzbau, steht auch heute, wie zu Beginn der Moderne, die Architektur wieder an einem Wendepunkt. Wie vormals kristallisiert sich am Ornament die neue Konzeption der Architektur heraus. Man darf sich nicht wundern, aber mehr denn je besitzt das Ornament eine Zukunftsorientierung. Das zeigt sich in Walter Gropius’ Ausruf:»Vorwärts zur Tradition! Das Ornament ist tot! Lang lebe das Ornament!«1
Das Ornament lässt sich, trotz seiner vielfältigen Erscheinungsformen, durchaus näher bestimmen. Man kann dazu auf Gottfried Semper Bezug nehmen. In seiner Schrift »Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder praktische Ästhetik« (1863) versuchte Semper, die theoretischen Grundlagen der Architektur zu beschreiben. Und es ist das Ornament, auf das alles hinausläuft und das im Zentrum des Verständnisses der Architektur steht.
Die Ornamente haben, so Semper, ihren Ausgangspunkt in den Prozessen des Machens und des Gemachtseins der Dinge. Sie können von nichts losgelöst werden. Vom stilistischen Standpunkt aus betrachtet trete das Ornament »uns nicht als etwas Absolutes, sondern als ein Resultat entgegen«2. Seinen Ursprung hat es einerseits in den materiellen und konstruktiven Verfahren, andererseits in der kulturell konnotierten Bearbeitung auf Seiten des Handwerkers. So kann man von der doppelten Polung des Ornaments sprechen, in den Worten von Semper einerseits von der struktivtechnischen Seite, andererseits von der struktivsymbolischen.
Logik der Konstruktion
Für Semper zeigt sich das an der Verknüpfung von Stoffen und Fellen zu größeren Flächen. Er sprach von der »struktiven Bedeutung der Naht«3 und von der Naht als Ausgangspunkt für Ornamente. »Die Naht ist wohl ein Nothbehelf, der erfunden ward, um Stücke homogener Art, und zwar Flächen, zu einem Ganzen zu verbinden.«4 Als Beispiel nannte er das Zusammennähen einzelner Felle zu größeren Stücken, wobei ihm als ethnologisches Anschauungsobjekt die Indianer dienten. Irgendwann genügte ihnen die Naht als konstruktives und funktionales Element nicht mehr. Sie fingen an, die Nähte mit komplizierteren Stichen zu überhöhen. Aus den einfachen Nähten wurden reiche Verzierungen, aus den Kreuzstichen Muster und sich wiederholende Ornamente. Ornamente sind also »bedungen durch die Art der Bearbeitung der Stoffe«5. Durch sie findet die Überführung der konstruktivtechnischen Verfahren in kulturell bedeutungsvolle Muster und Zeichen statt, die von Region zu Region, von Kultur zu Kultur variieren und ostfriesisch, oberbayerisch, slowakisch oder sizilianisch sind.
Ähnliches hat Vitruv in seinem ersten Theorietraktat der Architektur, in »De architectura libri decem«, schon beschrieben. Es entsteht das architektonische Ornament aus dem Übergang des antiken Tempels von der Holz zur Steinkonstruktion. Im Tempel in Stein verschwanden die Holzkonstruktionen von Decken und Dachstuhl hinter der steinernen Fassade. Damit stand die Architektur in Gefahr, eine abstrakte Figur zu werden, weil sich das Gebäude der Lesbarkeit und dem Verständnis seiner konstruktiven und konzeptuellen Logik entzog, weil es nicht mehr mitteilte, wie es gemacht und wie es konzipiert war. Ornamente machen die materiell-konstruktive wie auch die konzeptuell-kulturelle Logik sichtbar.
Deswegen hätten die Baumeister, so Vitruv, die Ornamente erfunden, zum Beispiel das Triglyphen und Metopenfries. Die Triglyphen sind stilisierte Balkenköpfe, sie zeigen die Position der Deckenbalken dahinter an, die Metopen den Raum dazwischen. Triglyphe und Metope haben selbst keine konstruktive Funktion, sie sind indexikalische Zeichen für etwas, was ohne sie unsichtbar bliebe. Über ihre konstruktive Verweisfunktion hinaus sind sie aber vom Handwerker oder Künstler beliebig bearbeitbar. Es kann die Triglyphe mit Bildmotiven und die Metope mit Reliefs oder das Säulenkapitell mit Pflanzenmotiven oder kunstvollen Fabelwesen verschönert werden, je nach Zeit, Region, Kultur und Meisterschaft des Handwerkers.
Logik der Kultur
Ornamente verbinden demnach zwei Erzählungen: Die Erzählung über die Konstruktion mit der Erzählung über die Kultur. Sie sind quasi das Interface, die Schnittstelle. Was bedeutet das aber für das Zeitalter der analogen und digitalen Maschinenproduktion, der Fertigteile, des 3D-Printing und der Verbundstoffe, wo vieles vorgerechnet und vorgefertigt ist und auf der Baustelle nur noch montiert wird, wo es keine Schrauben, Dübel oder Balkenschuhe mehr gibt und vieles geklebt ist? Wie zeigt sich dann die Logik der Holzverbindungen, wie finden sie ihre kulturelle, symbolische Aneignung? Die zentrale Frage ist, wie denn die kulturelle Aneignung des rein Technisch-Konstruktiven stattfinden kann, wenn der Handwerker nicht mehr Hand anlegt und keine Spuren der Bearbeitung sichtbar sind. Brauchen wir überhaupt noch die Ornamente? Sind wir wieder an dem Punkt – vielleicht Tiefpunkt – angelangt, an dem das Ornament einmal mehr abgeschafft werden kann?
Oder könnte es sein, dass mit den analogen wie auch digitalen Maschinenverfahren der ornamentale Prozess, unmerklich erst, sich verlagert hat von der Baustelle an den Anfang des Prozesses der Architektur und damit ins Entwerfen? Vielleicht kann man sogar von einer Rückkehr des Ornaments in den variierenden, computergenerierten Mustern sprechen, wie zum Beispiel in Achim Menges’ »Honeycomb Morphologies«, deren Gemachtsein trotz aller Algorithmen in den Verbindungen der einzelnen Zellen sichtbar wird. Es stellt sich an diesem Beispiel dennoch die Frage, wo sich die kulturelle Konnotierung, das symbolisch Spezifische des Entwurfs und der Architektur zeigt.
In diesem Zusammenhang stellen sich grundlegende Fragen, den kulturellen Status der Architektur betreffend. Die Honeycomb Morphologies sind erst einmal Unikate und Prototypen, ihre Formensprache ist noch nicht in die allgemeine Sprache der Kultur übergegangen. Wo die kulturelle Konnotierung noch fehlt, sind sie in diesem frühen Stadium mehr Muster als Ornament. Dazu muss festgestellt werden, dass die Ornamente in ihrem klassischen Gebrauch immer Figuren sind, die Teil des kulturellen Bewusstseins sind in je individueller Färbung durch die Bearbeitung des Handwerkers. Die neuen Formen heute müssen also einen Prozess durchmachen, damit sie ein neuer, bedeutungsvoller Teil der symbolischen Sprache der Architektur werden und den Status eines neuen Ornaments erwerben. Will man Beispiele nennen für Figuren, die aus einer technischen Form zu einer kulturell konnotierten Figur wurden, so lassen sich dafür die »Nierenform« der 1950er Jahre anführen und die typischen Tapetenmuster der 1970er Jahre oder die Kombination von freigelegtem Mauerwerk und verputzter Wand für die Postmoderne der 1980er Jahre. Auch wenn in den drei Beispielen der Handwerker nicht mehr maßgeblich an der Herstellung beteiligt ist, so handelt es sich doch um Muster, die durch Gebrauch mit einer zeitspezifischen Konnotierung kulturell zu Ornamenten aufgeladen sind.
1 Walter Gropius: »Für eine lebendige Architektur«, in: Hartmut Probst, Christian Schädlich: Walter Gropius. Ausgewählte Schriften, Bd. 3, Berlin 1983, S. 169.
2 Gottfried Semper: Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Ästhetik, Bd. 1: Die Textile Kunst, München 1878, S. 107.
3 Ebd., S. 77.
4 Ebd., S. 78.
5 Ebd., S. 177